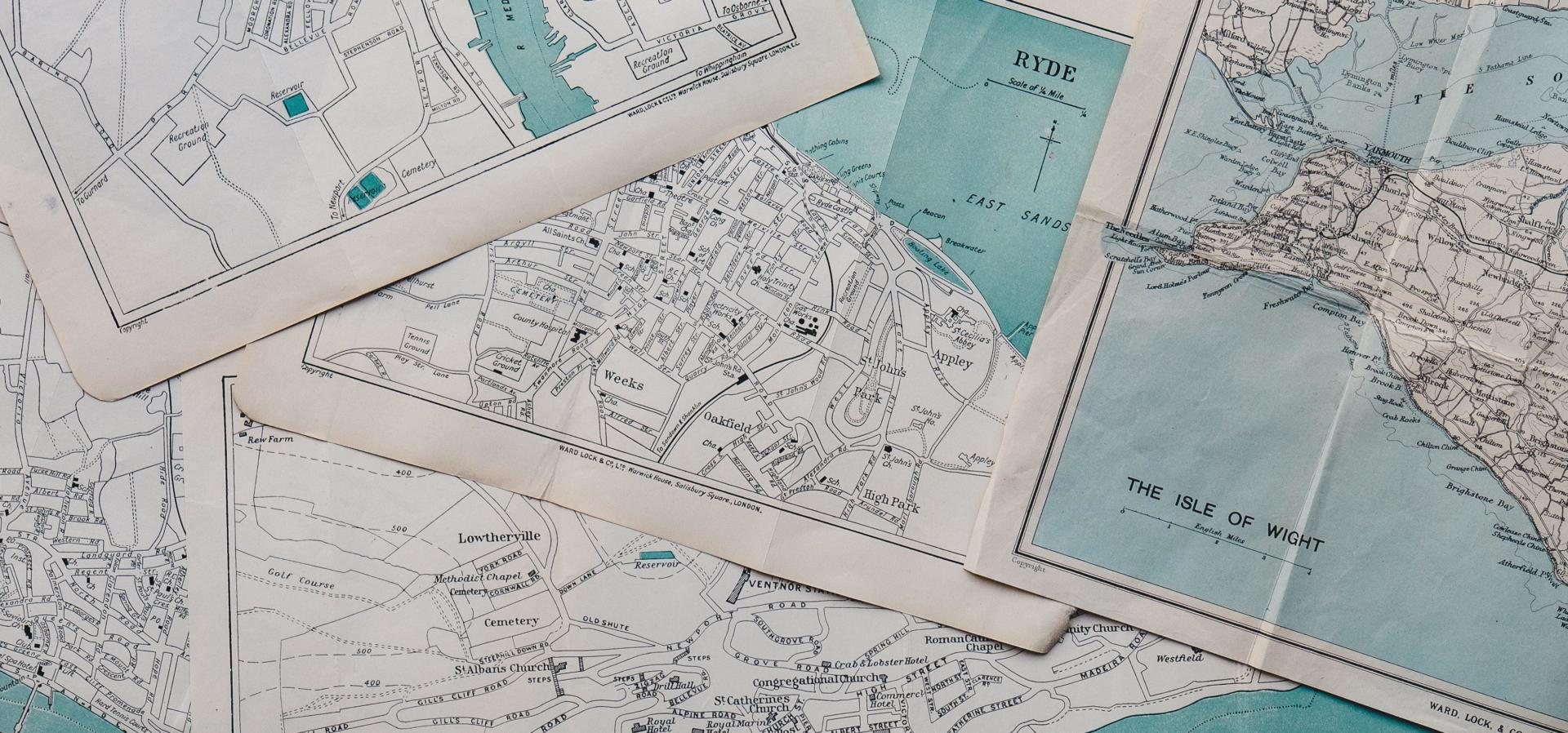CfP: Trauma im östlichen Europa – Begriff, Erfahrung, Gedächtnis in Ethnografie und historischer Anthropologie / Trauma in Eastern Europe – Concept, Experience, Memory in Ethnography and Historical Anthropology
Tagung an der Universität Graz, 12.-13. Juni 2026
(English text see below)
Die Gesellschaften des östlichen Europas sind in Vergangenheit und Gegenwart vielfältig von politischer und gesellschaftlicher Gewalt gezeichnet, von Krieg und Genozid, Vertreibung und Verfolgung. Vor allem aus westlicher Perspektive werden diese Erfahrungen in jüngerer Zeit in Begriffen des kollektiven oder individuellen Traumas gefasst.
Hierzu versucht die Tagung in drei ineinandergreifenden Bereichen ethnografischen, historisch-anthropologischen und ethnopsychoanalytischen Forschens einen Perspektivenwechsel: Tagungsbeiträge reflektieren die Begrifflichkeiten des Traumatischen in historischen und gegenwärtigen Kontexten des östlichen Europas. Sie erweitern das methodische Repertoire der Ethnografie um das subjektorientierte Forschen mit und über Menschen mit Gewalterfahrungen in östlich-europäischen Milieus, und sie fragen nach den Orten, Prägungen und Praktiken traumatischer Kollektivgedächtnisse.
Der Call richtet sich an interdisziplinär Forschende in ethnografisch, historisch und ethnopsychoanalytisch arbeitenden Fachbereichen. Gebeten wird um Beiträge aus süd-/ mittel-/ost-europäischen Forschungs- und Erfahrungsfeldern sowie aus Flucht- und Diasporagebieten. Sie beschäftigen sich mit diesen und ähnlichen Fragen:
- Begrifflichkeiten
Wie wurde Trauma im östlichen Europa im Laufe des 20. Jahrhunderts gedacht, beschrieben und verhandelt?
In diesem Themenfeld interessieren uns Beiträge, die die sprachlichen, medizinischen und gesellschaftlichen Deutungsmuster für gewaltvolle Erfahrungen in ihren historischen Kontexten untersuchen. Welche Begriffe standen und stehen zur Verfügung, um Krieg, Verfolgung, politische Repression oder strukturelle und physische Gewalt als Verletzung des Selbst zu benennen – und welche Erfahrungen blieben namenlos? Welche Konzepte von psychischer Erschütterung oder seelischem Leid wurden und werden in medizinischen, staatlichen, religiösen oder kulturellen Kontexten verwendet – und wie unterscheiden sie sich in unterschiedlichen politischen Regimen, etwa unter Monarchie, Faschismus, Sozialismus oder im postsowjetischen Raum?
Neben der Rezeption internationaler Klassifikationen – etwa des westlich geprägten PTSD-Begriffs – interessieren uns auch eigenständige oder wenig beachtete Konzeptionen von Trauma, wie sie sich etwa im polnischen „KZ-Syndrom“ oder in regionalen Diagnosepraktiken abzeichnen. Beiträge können danach fragen, wie solche Konzepte entstanden, mit welcher gesellschaftlichen Deutungsmacht sie ausgestattet waren – und welche ihrer Grenzen, Auslassungen oder Übersetzungsprobleme sich in der historischen wie ethnografischen Forschung zeigen.
Darüber hinaus geht es um die Frage, wie Begriffe des Traumatischen das Erzählen – und das Schweigen – über Gewalt geprägt haben. Wie wird über Zerstörung, Verlust und seelische Not gesprochen, wenn keine standardisierten Begriffe zur Verfügung stehen? In welchen Situationen wurde und wird Leid individualisiert, pathologisiert oder kollektiviert – in ethnografischen Gesprächen und Interviews, in Archivquellen, in alltäglichen Gesprächskontexten? Und welche Rolle spiel(t)en kulturelle Ausdrucksformen – Literatur, Theater, Film, Musik – bei der Formung alternativer Sprachen des Traumas?
Beiträge sind eingeladen, diese Dynamiken aus historischer, ethnografischer oder diskursanalytischer Perspektive zu beleuchten und damit auch zu fragen, wie Erinnerung, Begrifflichkeit und gesellschaftliche Deutungshoheit ineinandergreifen.
2. Forschungspraktiken
Wie beforschen wir traumatische Erfahrungen in Vergangenheit und Gegenwart?
Hierzu stellen sich diese und ähnliche Fragen: Wie gehen Forschende mit emotionalen und assoziativen Übertragungen zu gewaltsamen und traumatischen Erlebnissen in Forschungsgesprächen, aber auch in historischen Materialien um? Wie lässt sich darüber schreiben? Wie lässt sich zwischen dem Traumaerleben von Forschungspartner:innen und emotionalen Belastungen der Forscher:innen differenzieren und Distanz herstellen?
Welche methodischen und forschungsethischen Erweiterungen sind nötig?
Wie wirken gesellschaftliche Diskurse und Voreingenommenheiten in die Forschung ein, wie lässt sich damit umgehen? Wie wird die Forschung über traumatische Erfahrungen durch unseren wissenschaftlichen und persönlichen Blick, unsere Erfahrungshintergründe und die Voreinstellungen gesellschaftlicher (westlicher) Diskurse beeinflusst? Welche Rolle spielen im östlichen Europa verwurzelte Zeitzeug:innen als Forschende zu Gewalt und Trauma?
Wie kann der empathische Blickwechsel methodisch-ethnografisch oder historisch-anthropologisch begründet werden? Welche methodischen Beiträge zum Verstehen von Traumaerleben in Zusammenhängen von gesellschaftlicher Macht und Gewalt leistet die Ethnopsychoanalyse?
3. Kollektivgedächtnisse
Welche Umgangsweisen von Erinnern und Vergessen zeigen sich in kollektiven Gedächtnissen?
Wie manifestiert sich das (Post)Genozidale in kollektiven Gedächtnissen? Welche Rolle spielen Alltagspraxen (Erzählungen, Witze, Lieder, Mythen, Filme, Anekdoten) bei der Archivierung, Konservierung, Verfestigung, Überschreibung, Relativierung, Verharmlosung sowie Leugnung von Traumata? Welche gesellschaftlichen, politischen, kulturellen Dynamiken bringen sie hervor?
An welchen Orten und Räumen (Schauplätze von Verbrechen, Gedächtnisorte, Verhandlungs- und Vermittlungsorte, Orte der Diaspora, Social Media, Kunst) werden Erinnerungen ausverhandelt? Wie gehen Menschen und Bewegungen mit Umschreibungen und Unterdrückungen kollektiver Gewaltgedächntnisse um?
Wie werden Gewaltgedächtnisse aufgearbeitet? Welchen Herausforderungen begegnet die akademische und aktivistische Erinnerungsarbeit? An welchen theoretischen Konzepten kann sich die Erinnerungs- und Gewaltgedächtnisforschung des östlichen und südöstlichen Europa orientieren und welche Bedeutung können dabei Rassismusforschung (Antiziganismus, Antimuslimischer Rassismus, Antisemitismus) und Dekoloniale Theorien haben?
Wir freuen uns auf Einreichungen in englischer Sprache. Abstracts sollten 2000 Zeichen inkl. Leerzeichen nicht überschreiten. Sie enthalten eine knappe inhaltliche Zusammenfassung, Angaben zu Kontexten der Forschung, zu fachlichen, methodischen und theoretischen Zugangsweisen und den Bezügen des Beitrags zum Tagungsthema.
Geplant ist eine Publikation der Tagungsbeiträge, erwartet werden daher bislang unveröffentlichte Texte und die Bereitschaft, den eigenen Vortrag für die Publikation zu bearbeiten.
English version:
Both historically and today, the societies of Eastern Europe have been shaped in many ways by political and social violence, by war and genocide, expulsion, and persecution. Especially from a Western perspective, these experiences have increasingly been framed in terms of collective or individual trauma.
The conference seeks to shift perspectives in three interrelated areas of ethnographic, historical-anthropological, and ethno-psychoanalytic research. The contributions reflect on concepts of the traumatic in both historical and contemporary Eastern European contexts. They broaden the methodological repertoire of ethnography by incorporating subject-oriented research with and about people who have experienced violence in Eastern European settings, and they investigate the sites, influences, and practices of traumatic collective memories.
The call addresses interdisciplinary researchers working in ethnographic, historical, and ethno-psychoanalytic fields. We welcome contributions grounded in research and lived experience from Southern, Central, and Eastern Europe, as well as from contexts of displacement and diaspora. Submissions may engage with questions such as:
1. Concepts
How was trauma conceived, described, and negotiated in Eastern Europe over the course of the 20th century?
In this thematic field, we welcome contributions that analyse the linguistic, medical, and social frameworks used to interpret experiences of violence in their historical contexts. Which terms were — and are — available to describe war, persecution, political repression, or structural and physical violence as a violation of the self — and which experiences remained unnamed? Which concepts of psychological shock or mental suffering were and are used in medical, state, religious, or cultural contexts — and how do they differ across political regimes, for example under monarchy, fascism, socialism, or in the post-Soviet space?
Alongside the reception of international classificatory systems — such as the Western-influenced concept of PTSD — we are also interested in autonomous or lesser-known trauma concepts, such as the Polish “concentration camp syndrome” or region-specific diagnostic practices. Contributions may ask how such concepts emerged, what social interpretive authority they were granted — and which of their limitations, omissions, or translation problems become visible in historical and ethnographic research.
We are further interested in how concepts of the traumatic have shaped both the narration — and the silence — surrounding violence. How are destruction, loss, and emotional distress expressed when no standardised terminology is available? In which situations was — and is — suffering individualised, pathologised, or collectivised — in ethnographic conversations and interviews, in archival sources, or in everyday discourse? And what role do cultural forms of expression — literature, theatre, film, music — play in the formation of alternative languages of trauma?
Contributors are invited to explore these dynamics from historical, ethnographic, or discourse-analytical perspectives and to examine how memory, conceptualisation, and social authority over interpretation intersect.
2. Research Practices
How do we research traumatic experiences in the past and present?
This thematic field raises questions such as: How do researchers engage with emotional and associative transferences of violent and traumatic experiences in research interviews, but also in historical materials? How can these be written about? How can we distinguish between the trauma experienced by research participants, and the emotional burdens of the researchers themselves — and how can analytical distance be created? What methodological and research-ethical extensions are necessary?
How do social discourses and biases shape research, and how can they be addressed? How is research on traumatic experiences influenced by our academic and personal positioning, by our own backgrounds, and by the preconceptions of broader (Western) social discourses? What role do contemporary witnesses with roots in Eastern Europe play when they themselves conduct research on violence and trauma? How can an empathetic shift in perspective be methodologically justified — ethnographically or historically-anthropologically? And what methodological contributions does ethno-psychoanalysis offer for understanding experiences of trauma within contexts of social power and violence?
3. Collective Memories
What ways of dealing with remembering and forgetting are evident in collective memories?
How does the (post-)genocidal manifest itself in collective remembrance? What role do everyday practices — stories, jokes, songs, myths, films, anecdotes — play in the archiving, preservation, consolidation, overwriting, relativisation, trivialisation, or denial of trauma? What social, political, and cultural dynamics do they generate?
In which places and spaces — sites of violence, lieux de mémoire, arenas of negotiation and mediation, diasporic settings, social media, or art — are memories contested and renegotiated? How do individuals and movements respond to the rewriting and suppression of collective memories of violence?
How are memories of violence approached and transformed? What challenges confront academic and activist forms of memory work? Which theoretical frameworks can guide memory research and the study of violent pasts in Eastern and South-Eastern Europe, and what relevance might racism studies (anti-Roma racism, anti-Muslim racism, antisemitism) and decolonial theories hold in this context?
We welcome submissions in English. Abstracts should not exceed 2,000 characters, including spaces. They should contain a concise summary of the content, information on the research context, on technical, methodological and theoretical approaches, and the relevance of the contribution to the conference theme.
We plan to publish the conference proceedings, therefore we expect previously unpublished texts and a willingness to edit your own presentation for publication.
Die Einreichungen und etwaige Fragen richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse:
Please send your submissions and any questions to the following email address:
projekt.kulturanthropologie@uni-graz.at
Einsendeschluss / deadline for submissions:
31.1.2026
Für prekäre und nicht institutionelle Vortragende, insbesondere aus dem östlichen Europa, bemühen wir uns um anteilige Übernahme von Reisekosten und Übernachtungen.
For precarious and non-institutional presenters, especially from Eastern Europe, we endeavour to cover a proportion of travel and accommodation costs.
Das Organisationsteam in Graz wird die Beiträge auswählen und das Programm zusammenstellen. Eine Benachrichtigung über Annahme oder Ablehnung erfolgt Mitte Januar 2026.
The organising team in Graz will select the contributions and compile the programme. Notification of acceptance or rejection will be sent in mid-January 2026.
Wir freuen uns auf viele interessante Bewerbungen und eine spannende Tagung!
We look forward to receiving many interesting applications and to an exciting conference!
Für die Organisator:innen / For the organisers:
Katharina Eisch-Angus, Heike Karge, Kristina Trummer, Medina Velic
Veranstaltet von / Organised by:
- Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Universität Graz / Department of Cultural Anthropology and European Ethnology at the University of Graz
- Arbeitsbereich Südosteuropäische Geschichte und Anthropologie am Institut für Geschichte der Universität Graz / Section Southeast European History and Anthropology at the Department of History of the University of Graz
- Kommission für Kulturelle Kontexte des östlichen Europas in der Deutschen Gesellschaft für Empirische Kulturwissenschaft / Commission Cultural Contexts of Eastern Europe in the German Society for Empirical Cultural Studies
- Johann Gottfried Herder-Forschungsrat / Johann Gottfried Herder Research Council